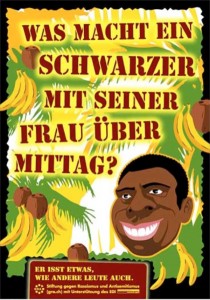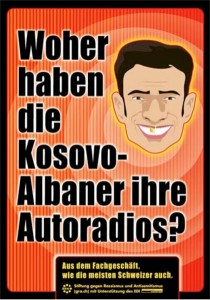Es ist Zeit, dass sich der Basler Wahlkampf auf wirklich wichtige Themen besinnt. Letzte Woche war an dieser Stelle von der neuen Einwanderung die Rede. Und von den Chancen, die aus der wachsenden Anziehungskraft unserer Stadt resultieren. Aber es gibt auch Risiken und Nebenwirkungen. Dazu gehört die drohende Wohnungsnot.

Diese öffnet der Immobilien-Spekulation Tür und Tor. Sie betrifft deshalb alle. In Zürich können wir beobachten, wie die Mieten wegen Raumknappheit jährlich um mehrere Prozentpunkte steigen. Wohnungssuche ist dort längst zum Kampfsport mutiert. Viele können sich die Stadt nicht mehr leisten. In zynischer Weise profitiert Zürich sogar finanziell davon, weil eine wachsende Zahl Sozialhilfebezüger in günstigere Gemeinden verdrängt werden. Zurück bleibt eine Wohlstands-Wüste.
Zürich hat immerhin noch Landreserven, um zu reagieren. Der dortige Stadtrat plant zehntausende neue Wohnungen. In Basel ist die Situation düster. Die «Kantonale Strategie zur Wohnraumentwicklung» sieht «etwa 4400 neue Wohnungen» in zehn Jahren vor. Je zur Hälfte soll das Ziel auf neu zu bebauenden Flächen und durch Verdichtung in bestehenden Quartieren erreicht werden. Mit anderen Worten: Im Vergleich zu heute ändert sich nichts. Denn es entstehen auch jetzt schon jährlich 400-500 neue Wohneinheiten.
Das ist viel zu wenig, und der Regierungsrat weiss es. Er sieht sich in einer Zwangslage. Der Kompromiss mit den Familiengärtnern lässt scheinbar keinen Raum für zusätzliche Neubaugebiete. Der Wahlkampf verlief bisher so, als ob es dieses Dilemma nicht gäbe. Dabei ist die Lösung der Wohnungsfrage für Basel vital. Nicht nur wegen der drohenden Not, sondern auch um Steuerzahler zu halten. Es geht ums Überleben des Standorts.
Eine Option ist die stärkere Verdichtung im Bestand. Diese ist aber für die Bevölkerung nur dann ein Qualitätsgewinn, wenn in der Umgebung mehr Strassen, Plätze und Höfe begrünt und kinderfreundlich gestaltet werden. Und wenn sich das Angebot des öffentlichen Verkehrs, für Velos und Fussgänger stark verbessert.
Die Beschleunigung und Verdichtung der Dreispitz-Überbauung oder das Projekt «Rheinhattan» rücken so in Reichweite. Gegen diese Entwicklung regt sich natürlich Opposition, wie bei jeder Veränderung. Doch wie stellen sich die Parteien dazu? Welche Strategie schlagen sie vor, um die Anliegen der Opposition zu verstehen und einzubeziehen?
In Basels Norden droht eine neue Polarisierung wie rund um die Familiengärten – und in der Folge der Stillstand. Um der wirtschaftlichen Dynamik gerecht zu werden, braucht es deutlich mutigere Eingriffe der Planung, als Viele wahrhaben wollen. Oder – als Alternative – ein Verzicht auf Entwicklung. Wer was will, sollte sich im Wahlkampf zeigen.