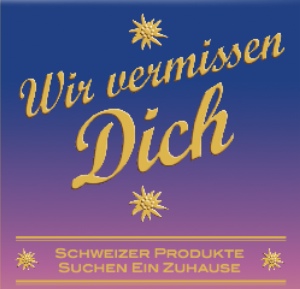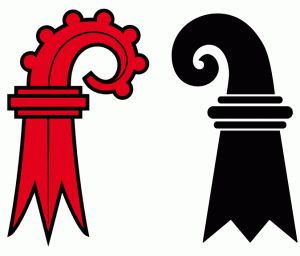Marcel Schweizer und Peter Malama sei Dank. Mit ihrer «Parkplatz-Initiative» hat das Führungsduo an der Spitze des Basler Gewerbeverbandes alles klar gemacht. Die Ablehnung mit einer Mehrheit von fast zwei Dritteln der Stimmen legt – zusammen mit drei weiteren Urnengängen der letzten 24 Monate – eine solide Basis für die Verkehrspolitik des Kantons. Jetzt ist die Zeit gekommen, von den Niederungen der Tagespolitik aufzusteigen und die ganze Region sowie einen längeren Zeithorizont ins Auge zu fassen.

Es ist die Mobilität von Menschen, Ideen, Daten, Energie und Gütern, die eine Region zusammen hält. Der Adlerblick über die Stadt Basel mit 900 000 Einwohnern in drei Ländern, vier Kantonen und einer Vielzahl von Landkreisen, Distrikten und Gemeinden zeigt: Die Stadt ist weit davon entfernt, klug und weitsichtig verbunden zu sein. Es klaffen Lücken, weil sich kaum jemand zuständig fühlt, integrierend zu denken. Obwohl es zu diesem Zweck viele Gremien gibt. Auf diese zu warten, bringt aber wenig.
Mit vier Volksentscheiden im Rücken, ist der Basler Regierungsrat verpflichtet und legitimiert, die Initiative zu ergreifen. Dies wird von ihm auch rundum erwartet. Denn Basel kann die verkehrspolitischen Aufträge der Wählerschaft aus rein städtischer Optik heraus gar nicht erfüllen. Es braucht dafür überlegte, übergeordnete und zugleich mutige Visionen. Daher ist es auch Zeit, das Wort «Visionen» zu rehabilitieren. Zu Unrecht kam es in Verruf, nach dem Motto: «Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.»
Jedes Unternehmen braucht eine Vision, jedes Gemeinwesen ein Leitbild. Unsere Vorstellungen der zukünftigen Mobilität prägen die Realität, wie sie die nächste Generation antreffen wird. Es lohnt sich, hier zu investieren.
Nur auf diesem Weg sehen wir, dass zum Beispiel eine direkte Verbindung vom Bahnhof SBB über den Flughafen in Richtung Freiburg im Breisgau (mit einer neuen Rheinbrücke auf der Höhe des Kraftwerks Kembs) Sinn macht und die Reisezeiten auf der Nord-Süd-Strecke deutlich verkürzt. Nur so erschliesst sich die Dringlichkeit des S-Bahn-Herzstücks unter der Basler Innenstadt. Aus der Froschperspektive des Marktplatzes leuchtet dieses Projekt kaum ein.
Ein neuer Hafen rechtfertigt sich nur im weiteren Kontext. Die Vernetzung der Energiesysteme oder von Datenleitungen ist zwar weniger sichtbar, aber ebenso dringend wie produktiv. Basel an der Schnittstelle von drei Ländern hat hier ein grosses Potenzial.
Solche Chancen werden aber nur greifbar, wenn sich der Kanton Basel-Stadt zwei Dinge zutraut: Erstens eine Führungsrolle zu übernehmen und zweitens eine Vision fürs grosse Ganze zu entwickeln. Dass diese anschliessend in einem offenen und intensiven Dialog mit den Nachbarn geschärft, überarbeitet und in eine verbindliche Form gebracht werden muss, versteht sich von selbst.