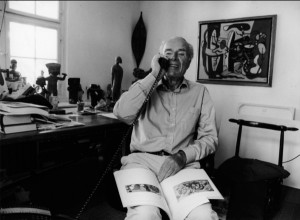Klimaleugner oder Klimaskeptiker heissen seltsamerweise Menschen, die in Abrede stellen, dass es eine Klimaerwärmung gibt. Während Klimakonferenzen – wie gegenwärtig in Durban – haben die Klimaleugner Hochkonjunktur. Neben dem harten Kern der Klimaleugner, die jede Erwärmung abstreiten, gibt es noch zwei Unterarten: Jene, die zwar eine potenziell katastrophale Erwärmung erwarten, diese aber als natürliche Schwankung interpretieren. Sowie jene, die ebenfalls an eine Erwärmung glauben, sie aber als harmlos betrachten.

Die Delegierten der Klimakonferenz COP 17 in Südafrika gehen hingegen davon aus, dass es die vom Menschen verursachte Klimaerwärmung gibt. Sie diskutieren Massnahmen, um den Untergang von Inseln, die Häufung von Überschwemmungen, das Abschmelzen der Gletscher und viele andere Gefahren zu bannen. An dieser unheilvollen Perspektive ändert auch eine allfällige wirtschaftliche Flaute nichts. Sie verzögert höchstens den Prozess, weil die Menschen weniger konsumieren und damit auch weniger Treibhausgase entstehen.
In der Krise fragen sich hingegen manche, ob wir uns den Klimaschutz noch leisten können. Da fallen die Argumente der Klimaleugner auf besonders fruchtbaren Boden. Es könnte ja sein, dass alle Anstrengungen umsonst weil überflüssig sind. Es wäre fahrlässig, dies zu glauben. Selbst wer Zweifel hegt an der Korrektheit der wissenschaftlich abgestützten Voraussagen, müsste die Investitionen in den Klimaschutz als Risikominimierung und Schutzschild akzeptieren. Bei der gegenwärtigen Datenlage ein Klimaexperiment im globalen Massstab zu wagen, wäre unverantwortlich.
Deshalb ist es richtig, dass Basel-Stadt den Weg zur 2000 Watt Gesellschaft und den Ausstieg aus der fossilen Energie systematisch weiter geht. Zum Beispiel indem das Amt für Umwelt und Energie dieser Tage eine Internet-Applikation lanciert, welche es jedem Hausbesitzer erlaubt nachzuschauen, ob sich eine Solaranlage auf dem Dach auszahlen würde.
Noch einen Schritt weiter geht jedoch die Chinesische Regierung. In einer Präsentation in Durban legten deren Funktionäre dar, weshalb China so oder so den Weg der «low carbon economy» (etwa: kohlenstoffarme Wirtschaft) gehen wird: «Wir können uns gar nichts anderes Leisten. Wenn wir Wohlstand für alle wollen, ohne die Umwelt und Ressourcen zu zerstören, sind wir gezwungen, mit dem Klimaschutz ernst zu machen», sagte der Leiter der einflussreichen Nationalen Reform- und Entwicklungskommission Chinas.
Dahinter verbirgt sich noch eine andere Logik: Wer heute den unvermeidbaren Umstieg aus der fossilen Vergangenheit in die erneuerbare Zukunft wagt, der positioniert sich in lukrativen Märkten. Eines Tages werden die Basler selbst in Zürich Solardächer montieren und Strom ins Netz einspeisen.