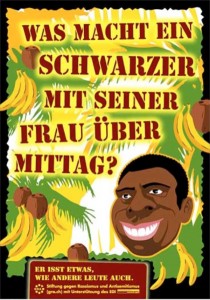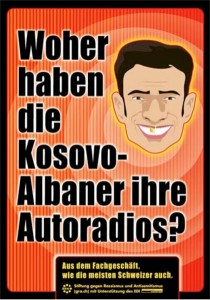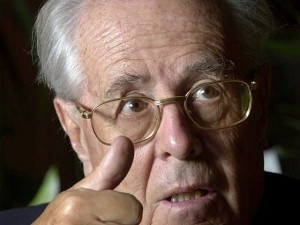Die Kontroverse um das geplante Parkhaus beim Kunstmuseum hat eine neue Wendung genommen. Jetzt liegt der Plan auf dem Tisch, 300 Parkfelder unter einem Neubau zu platzieren, den die Swisscanto an der Dufourstrasse 9/11 zu errichten gedenkt. Die Akzeptanz ihres Vorhabens testet die Grundeigentümerin gegenwärtig mit einem «generellen Baubegehren».

Viel interessanter als die Diskussion der Parkhausfrage erscheint mir der Blick auf die oberirdische Struktur. Swisscanto will das Bürohaus aus den 50er-Jahren durch einen Neubau mit Läden, Büros und 26 Wohnungen ersetzen. Dieser Vorschlag trägt dem besonderen städtebaulichen Potenzial der Lage kaum Rechnung. Es ist ein erklärtes Ziel der Basler Regierung, den Wohnungsbau auf geeigneten Parzellen durch Verdichtung zu fördern. Dies gilt ganz besonders für Orte, die durch den öffentlichen Verkehr gut erschlossen sind und nahe an Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Arbeitsplätzen, Freizeiteinrichtungen und anderen städtischen Infrastrukturen liegen.
Da die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner nur kurze Wege zurücklegen müssen, kann zentrales Wohnen die Verkehrsbelastung deutlich reduzieren helfen. Die Innenstadt lässt sich auf diese Weise beleben, und das lokale Gewerbe gewinnt neue Kundinnen und Kunden.
26 Logis sind daher für die Dufourstrasse 9/11 deutlich zu wenige. Es hätten auf diesem Gelände weit über 100 Wohnungen Platz – in einem vielleicht 50 Meter hohen Turm. Diese Höhe würde es erlauben, auf dem Grundstück trotz Verdichtung Raum frei zu halten für einen lauschigen, öffentlichen Kleinpark zum Museumsneubau hin. Zudem ist es nicht egal, was im Erdgeschoss eines Hauses geschieht, das in unmittelbare Nachbarschaft einer Kunststätte von globalem Rang zu stehen kommt. Beispiele für öffentliche Nutzungen an dieser Stelle wären ein Galerienzentrum, Verkaufslokale für die Kreativwirtschaft oder experimentelle Räume.
Doch zurück zum Hochhaus: Dieses würde einen wünschenswerten Akzent in der Silhouette des Grossbasel setzen. Besonders reizvoll wäre der Dialog des neuen Gebäudes mit den Türmen von Münster und Elisabethenkirche, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, aber auch mit dem 70 Meter aufragenden Lifescience-Forschungszentrum der Universität Basel am anderen Ende der Altstadt, beim Schällemätteli.
Eher früher als später wird auch das Klinikum II des Unispitals ersetzt, dessen Grundstrukturen eine zeitgemässe Renovation kaum mehr zulassen. Auch dieser Neubau wird nicht mehr – wie der heutige – ein klein wenig, sondern deutlich über die Dächer der Altstadt hinausragen. Damit würden neue Orientierungspunkte gesetzt. Und die Turmlandschaft, die gegenwärtig auf der Kleinbasler Rheinseite in den Himmel wächst, erhielte ein ansprechendes Gegenüber.