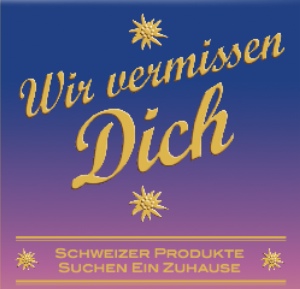Bischof Heinrich von Thun, der damalige Stadtregent, fällte um 1225 den wohl folgenreichsten Investitionsentscheid in der Geschichte Basels: Er liess die Mittlere Rheinbrücke errichten. Seither verbindet dieses Bauwerk nicht nur Gross- und Kleinbasel. Es steht auch sinnbildlich für eine weltoffene, auf friedlichen Handel und Wandel erpichte Polis. Die Integration von Menschen und Ideen aus allen Himmelsrichtungen, die Innovation als wirtschaftliche Triebfeder und die Pflege politischer Stabilität prägen seit dem Brückenschlag das Entwicklungsmodell Basels.

Dieses Entwicklungsmodell könnte die nächste Landesausstellung inspirieren, denn es ist für die Schweiz im 21. Jahrhundert wegweisend. Am Vorabend des 2. Weltkriegs war es Zürichs Fluidum, die Besinnung auf eigene Stärken, die 1939 der nationalen Nabelschau ihren Stempel aufdrückte. Die Expo Lausanne 1964 markierte den Aufbruch der Schweiz in eine technikgläubige Wohlstandsgesellschaft.
Anfangs dieses Jahrhunderts, an der Expo 2002, war angesichts mannigfaltiger sozialer und ökologischer Krisen Nachhaltigkeit die Lösung. Diese wurde seltsamerweise so verstanden: Am Ende musste die ganze Landschaft um Neuenburg, Murten, Biel und Yverdon wieder in den alten Zustand zurückversetzt werden – als ob nichts geschehen wäre.
Die heutige Schweiz hat grösste Mühe mit der notwendigen Öffnung für Europa und die Welt. Sie hat Angst, unterzugehen, ihre Identität zu verlieren. Der Beitritt zur EU ist dabei eher eine Nebenfrage. Wichtig ist die tatsächliche Kooperation mit Partnern in der Nachbarschaft und in Übersee, wie sie die Wirtschaft zwar praktiziert, der durchschnittliche Bürger aber gerne ignoriert. Unter dem Motto «Weltoffene Schweiz» könnte Basel 2025 – zum 800-jährigen Jubiläum der Rheinbrücke – die Schweiz und die Welt zur nächsten «Landi» einladen. Gemeinsam mit den Nachbarn würde sogar eine «Dreilandi» draus.
2025 werden die Werke der Internationalen Bauausstellung (IBA) zu besichtigen sein, welche ab November 2011 auf den Weg gebracht werden. Möglicherweise ist Basel dann auch «Kulturhauptstadt Europas». Und hoffentlich lebt es mit dem Baselbiet in Eintracht (ob fusioniert oder nicht).
Basel und die Region brauchen ein gemeinsames Projekt, um sich zu finden, aber auch um sich auf die Landkarte zu setzen, für die Schweiz und für Europa. Ein solches Projekt mit bedeutender Aussenwirkung trüge viel effektiver und langfristiger zur Geltung Basels bei, als es Lobbying-Stellen in Bern oder PR-Auftritte in Deutschen Städten tun. Die Schweiz, die Welt zu Gast in Basel – ein konstruktiver Plan für die nächste parlamentarische Legislatur.