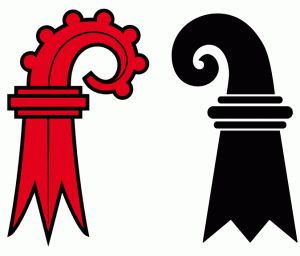Annette Schönholzer und Marc Spiegler, Direktorin und Direktor der Art Basel, sind jetzt wohl in den Ferien. Denn ihre hiesige Show ist vorbei und ihre nächste, die Art Basel Miami Beach, noch Monate entfernt. Die letzten Reste der Kunstmesse sind zusammengekehrt und die leeren Hallen dösen im Sommerschlaf. Eine knappe Woche hat das Spektakel gedauert, das Basel in eine temporäre Weltstadt verwandelte.

Und nun? Die schöne, ruhige Zeit ist angebrochen, sagen manche. Nächste Woche soll auch die Hitze zurückkehren, die uns in der Rheinebene flimmernde Nachmittage beschert und zuweilen schwer in den Strassen lastet. Kultur ist dünn gesät. Das Tattoo ist nicht jedermanns Sache und das Stimmen Festival kaum abendfüllend.
Wie wäre es mit einer aktuellen, hochkarätigen, jeden Sommer neuen Kunstausstellung? Teuer käme Basel ein solcher globaler Anziehungspunkt nicht zu stehen: Es würde reichen, die spektakuläre Art Unlimited (inklusive ihrer Kunstwerke im öffentlichen Raum) stehen zu lassen und über den Sommer zu bewachen, zu versichern, zu bewerben und vielleicht mit einer kleinen, gescheiten Veranstaltungsreihe zu ergänzen.
Dies würde nicht bloss die Hoteliers freuen, sondern auch für Daheimgebliebene eine Lücke füllen, die wir alle empfinden: Das Loch nach der Art. Darüber hinaus – und vielleicht in erster Linie – könnte der Basler Kunstsommer Ausgangspunkt für neue Veranstaltungs-Formate und eine inhaltlich innovative Stadtentwicklung sein.
Anderswo gibt es in der heissen Jahreszeit erfolgreiche Theaterspektakel, Sommernachtsfeste, Sommerfestspiele, Openairs, Skulpturen in Parks, Filmfestivals, Biennalen und vieles mehr. Neben Erbauung und Unterhaltung zählen dabei vor allem die Wertschöpfung und der Imagegewinn.

Ein gescheit kuratierter Kunstsommer, wie ihn Basel durch die Verlängerung der Art Unlimited zu bieten hätte, würde weiter reichen. In Zusammenarbeit mit den vertretenen Galerien könnten die ausgestellten Künstlerinnen und Künstler eingeladen werden, inhaltliche Beiträge zur Stadt (im Speziellen oder Allgemeinen) zu erarbeiten und diese in Diskussionen und Aktionen mit dem Publikum zu vertiefen.
Damit würde die Art für Basel viel mehr leisten, als nur kurzfristiger Marktplatz und Geschäftsanlass zu sein. Und die Kunstschaffenden bekämen ein Forum, das vielleicht am ehesten mit der Kasseler Documenta 5 von 1972 (und der Documenta 6 von 1977) vergleichbar ist. Künstler und Kuratoren wie Joseph Beuys, Harald Szeemann und Jean Christophe Ammann drückten damals diesen Anlässen ihren Stempel auf. Ein konzeptionelles Motto, zum Beispiel „Die Kunst und die Stadt“, liesse sich vielfach variieren und weckte das Interesse weit über die enge, mondäne und in letzter Zeit allzu kommerzielle Art-Familie hinaus.