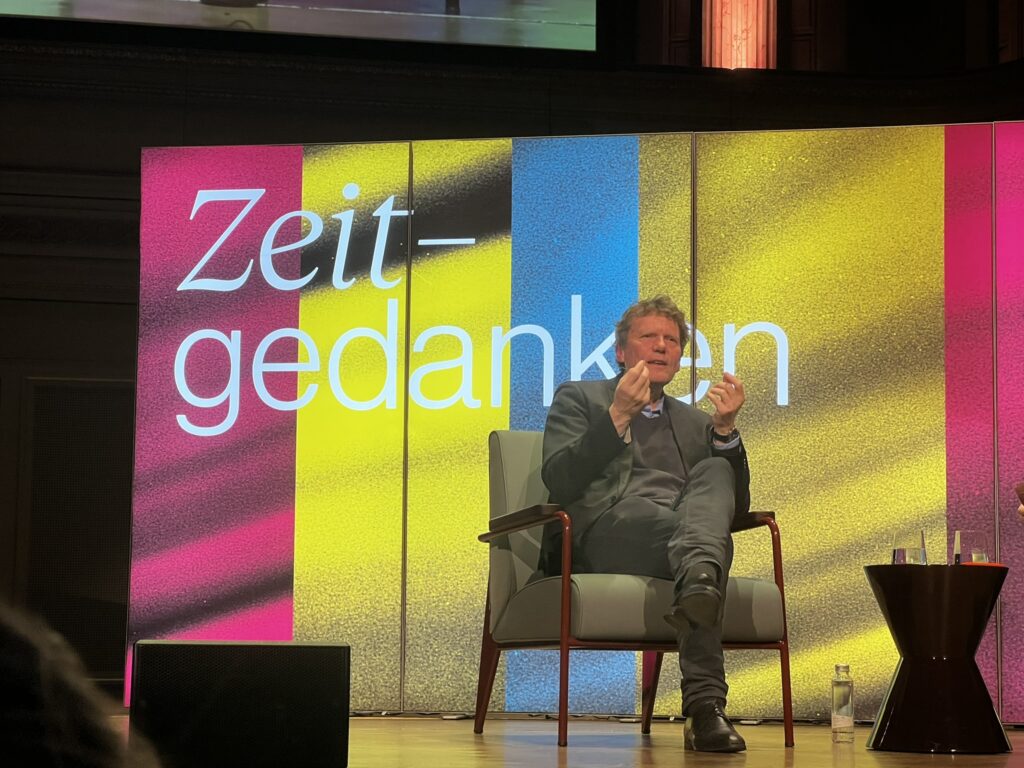Die Bundesgelder für dringende Infrastrukturbedürfnisse sind bekanntlich knapp. Kriegt nun Basel oder Luzern einen unterirdischen Bahnhof? Am besten beide, das könnte mit privaten Finanzierungen möglich werden.
Von Karin Bührer und Daniel Wiener*
Als Gründungsmitglieder des ersten Gotthardkomitees sind Basel-Stadt undLuzern schon seit 1853 freundschaftlich verbunden. Das damals verbindende Ziel hiess «Überschienung des Gotthards». Nun droht dieses Bündnis zu zerbrechen.

Im nächsten Jahr wird der Bundesrat darüber entscheiden, welche «Engpassbeseitigung» wie viel Geld für eine Linderung bekommt. Geld, das im gleichen Topf ist, nämlich im «Ausbauschritt 2045» mit dem fabulösen Namen
FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur). Und um diesen Honigtopf kreisen viele weitere Bienen aus der ganzen Schweiz.
Zur Engpassbeseitigung planen Luzern und Basel die gleiche Lösung, nämlich eine unterirdische Querung nach dem Vorbild von Zürich. In Basel heisst das Projekt «Herzstück», weil es auch weitere Bahnhöfe einschliesst, in Luzern «Durchgangsbahnhof». Beide Tunnels sind etwa vier Kilometer lang, kosten mehrere Milliarden Franken, sollen nach dem Wunsch der Kantone 2040
eröffnet werden und sind aus ihrer Sicht «unverzichtbar».
Damit machen sich Luzern und Basel zu Konkurrenten. Es werden Allianzen geschmiedet, Strategien entworfen, Gespräche geführt, Delegationen weibeln nach Bern und PR-Agenturen sind am Werk, um kleinere und grössere Vorteile für sich zu erzielen. Es ginge auch anders.
Zwar ist der ÖV-Ausbau politisch konsensfähig, gemäss Volksabstimmungen sogar populär, gerade weil er auch die Strasse entlastet, aber auch als umweltfreundliche Alternative dazu. Fakt ist aber, dass all die Infrastrukturwünsche der Kantone die Budgets der öffentlichen Hand bei weitem übersteigen.
Die Kantone möchten den Ausbau, um die Bedürfnisse zu erfüllen, die aus der Bevölkerungszunahme resultieren. Diese betrifft überproportional die Agglomerationen, die bisher schlecht mit dem ÖV erschlossen sind.
Die Gestaltung unseres Landes sollte dabei nicht in erster Linie davon abhängig sein, wie viel Geld kurzfristig in der Kasse liegt, sondern auf langfristige Zyklen achten. Das war schon immer ein Erfolgsmodell der Schweiz. Und dabei spielten private Investorinnen und Investoren jeweils eine wesentliche Rolle: Ohne sie wären Wasserkraftwerke in den Alpen, zahlreiche Eisenbahnlinien, Seilbahnen und Hotelanlagen, die Rheinschifffahrt und auch manches Spital sowie viele Schulen nie entstanden. Die Schweizer Infrastruktur lebt von diesem gesunden Mix von öffentlich und privat, damit der Fiskus nicht zum willkürlich limitierenden Faktor bei ihrem Ausbau wird.
Angenommen, es kämen auch Private als Investorinnen und Investoren der Bahnausbauten von Basel und Luzern infrage. Dann hätte der Bund freie Hand, beide Projekte, deren Sinn kaum bestritten wird, voranzutreiben, und zwar ohne fiskalische oder zeitliche Einschränkungen.
Der Lackmustest einer privaten Finanzierung oder Mitfinanzierung würde die Nachfragegerechtigkeit der neuen Angebote garantieren: Eine private Tunnelgesellschaft für Luzern und Basel würde nicht nur den Bau, sondern auch Betrieb und Unterhalt dieser Teilstrecken tragen.
Sie müsste in der Konzession, zum Beispiel während 30 Jahren, eine minimale Verfügbarkeit der Infrastruktur von beispielsweise 99% gewährleisten. Dafür bekäme sie pro Zug, der die Anlage benützt, eine Gebühr, um ihre Investition zu verzinsen und zu amortisieren. Nur wenn diese Nachfrage zu kostentragenden Preisen garantiert werden kann, gilt ein solches Projekt als wirtschaftlich. Ob ein Vorhaben sinnvoll ist oder nicht, liesse sich unter anderem an solchen Massstäben messen.
Natürlich liegen die Finanzierungskosten des Bundes tiefer als jene von Privaten. Auf der anderen Seite muss die öffentliche Hand aber alle Leistungen nach WTO-Regeln ausschreiben, was ein starres Kostenkorsett zur Folge hat. Private dagegen können – gemäss Schätzungen aus dem Bundesamt für Verkehr – durch Verhandlungen bis zu einem Drittel billiger beschaffen. Das gilt sowohl für Planungs- und Baumassnahmen als auch für den Unterhalt und andere Dienstleistungen.
Sollte ein Privater per saldo etwas höhere Trassenpreise verrechnen müssen, würde dies ohnehin nur während der Konzessionsdauer, also etwa den ersten 30 Jahren, ins Gewicht fallen. Die frühere Verfügbarkeit der Infrastruktur wiegt diesen möglichen Nachteil bei weitem auf.
Da alle hoffen, das Rennen um öffentliche Gelder zu machen, werden mögliche Alternativen tabuisiert. Nachgelagert würden – und das sei nur nebenbei bemerkt – bessere Anlagemöglichkeiten in Schweizer Infrastruktur dämpfend auf die Wohnungspreise wirken. Beispielsweise könnten Pensionskassen Teile ihrer Immobilienanlagen in inländische Infrastrukturinvestitionen verlagern. Denn Infrastruktur bietet den gleichen Inflationsschutz und ähnliche, regelmässige Renditen wie die Finanzierung von Wohn- und Geschäftsbauten.
* Dieser Beitrag erschien am 23. Januar 2025 in der NZZ.
Karin Bührer ist Geschäftsleiterin von Entwicklung Schweiz.